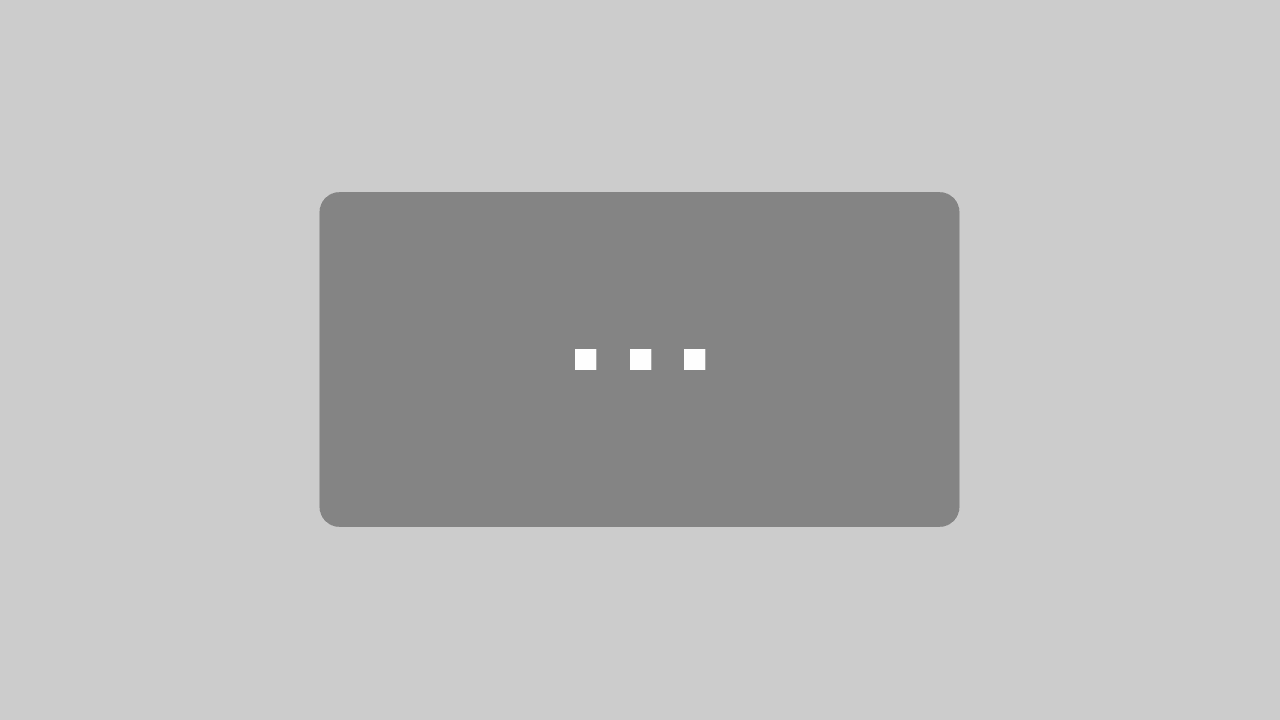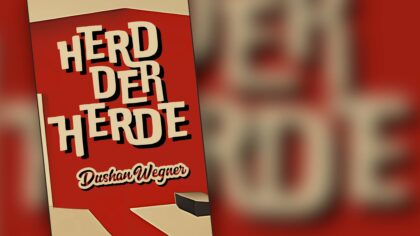»Herr Wegner«, so sagte ein Leser, »warum leiten Sie Ihre Texte immer mit diesen Geschichten ein? Warum sagen Sie nicht einfach, was Sache ist, warum kommen Sie nicht einfach so auf den Punkt? – Ich will es gern beantworten, doch zuerst: Eine Geschichte!
Es war einmal ein Dorf, und es standen darum drei hohe Berge, alle drei bis zu ihrer halben Höhe mit dunklen Wäldern bewachsen, und die Berge hießen die »Drei Geschwister«, und zwischen den Drei Geschwistern lag ein Tal, und in diesem Tal, wie ein Kind in der Krippe, lag eben unser Dorf.
Einst war das Dorf zwischen den drei Geschwistern reich gewesen, sein Marktplatz war schmuck, die Schüler galten als klug und fanden auch in den Städten gute Arbeit, der Dorfbrunnen hielt allezeit frisches Wasser bereit, für Durchreisende wie für die eigenen Menschen, und die makellose Kirche schenkte dem eigenen Dorf wie auch den Gläubigen der Nachbardörfer die Einkehr, die Ruhe, die Hoffnungssplitter, derer wir alle so sehr bedürfen.
Viele Jahre später, nach den Ereignissen, von denen wir hier berichten, würden Forscher herausfinden, dass womöglich giftige Dämpfe aus der Erde gestiegen waren, dass sie das Denken der Menschen im Dorf benebelt haben könnten, doch damals wussten die Bewohner das noch nicht, und sie dachten sich nichts dabei, dass sie so dachten, wie sie dachten.
Wenige Jahre zuvor, damals, als sich wohl jene Erdspalte unbemerkt geöffnet hatte, und als die Dämpfe aus der Erde zu steigen begonnen hatten, damals hatte es noch eine große Aufregung gegeben. Kinder hatten unten am Fluss gespielt, und sie hatten einen Geruch wie von Bienenwachs bemerkt, und dann sahen sie, oben auf den Hängen aller drei Geschwister, wie Geister über den Wäldern schwebten und zu ihnen ins Tal herunterkamen, doch kaum hatten sie die Geister auf den Hängen erblickt, waren dieselben Geister auch schon mitten unter ihnen, gleich überm Wasser, ein Gespenst vor jedem, und die Gespenster sagten nichts, die Geister blickten nur zurück, immer auf denjenigen, der sie ansah.
Die Kinder liefen ins Dorf zurück, und sie wollten von den Geistern erzählen, doch auch im Dorf hatte sich eine Erdspalte geöffnet, unter der alten Schule, und die Luft roch wieder nach Bienenwachs, und auch die Gespenster vom Fluss waren nun im Dorf, zusammen mit vielen weiteren Geistern, und die Menschen liefen auf der Straße herum, und die einen Menschen starrten das ihnen zugeordnete Gespenst nur stumm an, andere schrien es an oder schlugen sogar mit dem Stock nach ihm, doch schneller als man meinen würde arrangierten sich die Menschen mit den Geistern.
Die Gespenster redeten ja nicht selbst, sie waren ja nicht wirklich, sie waren Kinder vergifteter Hirne, doch für eben diese Hirne waren die Gespenster nicht weniger echt und wirklich als die eigene Hand, die man vor seinen Augen sieht – und doch blieben sie ihnen unheimlich.
Die Bewohner wurden sich bald einig, dass die Gespenster, nicht trotz, sondern gerade wegen der gruseligen Vertrautheit, etwas Böses und also zu bekämpfen waren. Man berief eine Dorfkommission für den Kampf gegen die Gespenster, man befragte jeden, der sich als Fachmann für Gespensterkunde ausgab, und bald gehörte es zum guten Ton, alles was man im Dorf tat im Namen des Kampfes gegen die Gespenster auszuführen.
Einer wollte den Giebel seines Hauses nach vorne zum Dorfplatz hin strecken, und das verstieß eigentlich gegen die Dorfordnung, und es wurde ihm nicht gestattet, doch als er sich vorm Dorfrat auf den Kampf gegen die Gespenster berief, wurde es ihm nicht nur erlaubt, sondern er erhielt sogar noch einen Zuschuss aus der Dorfkasse. Ein Halbstarker, der einen Großvater überfallen hatte, redete sich vorm Dorfrichter damit heraus, er habe den Großvater für ein Gespenst gehalten, und solle man etwa nicht gegen die Gespenster kämpfen? Der Dorfrichter traute sich schon lange nicht mehr, jemanden zu verurteilen, wenn dieser nur sagte, er habe das, was er getan hatte, im Kampf gegen die Gespenster getan.
Und dann waren die Gespenster wieder fort – eigentlich. Es ist im Nachhinein nicht präzise zu bestimmen, ob die giftigen Dämpfe versiegt waren, oder ob die Leute eine Resistenz gegen die wabernden Gifte entwickelt hatten, doch was auch der Grund war – einer nach dem anderen krochen die Gespenster wieder die Hänge der Drei Geschwister hoch, lösten sich auf und verschwanden. Mancher Dorfbewohner sagte gar, es hätte ohnehin viel, viel weniger Gespenster gegeben, als die Menschen zu sehen behauptet hätten. Kein Historiker bestreitet jedoch, dass sich die einfachen Dorfbewohner noch Generationen später vor den Gespenstern fürchteten.
Wer im Dorf eine angesehene Position bekleiden wollte, sei es zum Nachtaufseher, ein durchaus gut bezahlter Posten, oder wer in den Rat der Dorfältesten, dem diente es zum Vorteil, wenn er sich darauf verstand, den Leuten ein feines Gruseln über den abergläubischen Rücken zu treiben.
Der Bau eines neuen Brunnens stand an, und zwei Brunnenbauer bewarben sich. Der eine legte seine Referenzen vor, er verfügte über Kenntnisse und das notwendige Werkzeug. Der andere vermochte weder Referenzen noch Kenntnisse noch das notwendige Werkzeug vorzuweisen – doch er verstand sich trefflich darauf, über die Gefahr der Gespenster zu reden, und also erhielt er den Auftrag.
Der Brunnen wurde nie fertig – und der Brunnen war nicht das einzige Vorhaben, das derart scheiterte. Das neue Kirchendach wurde zwar fertig, der Form nach zumindest, doch beim ersten Sturm schon brach es ein. Der alte Dorflehrer sah bald nicht nur sein eines Gespenst, sondern Dutzende und Hunderte, jede Nacht, und nachdem er dann ganz verrückt geworden und in die Wälder der drei Geschwister geflohen war, suchten sie einen neuen Dorflehrer. Sie fanden einen, und ein Jahr später stellte man fest, dass die Kinder bei dem nichts lernten, weil der neue Lehrer selbst kaum lesen, schreiben oder rechnen konnte, weil der Neue wenig mehr als Spukgeschichten über die Gespenster zu erzählen wusste.
In den Geschichten und Märchen, wie wir sie aus unseren alten Büchern kennen, wie sie uns, wenn wir so glücklich waren, unsere Eltern vorm Schlafengehen vorlasen, wie wir sie, wenn wir klug wurden, später selbst gelesen haben, in jenen Geschichten und Märchen tritt spätestens an diesem Punkt ein Held auf, geschieht ein Wunder, schlägt sich höhere Erkenntnis und Gerechtigkeit die Bahn – doch dies ist nicht so eine Geschichte.
Unser Dorf im Tal zwischen den Drei Geschwistern, das Dorf, in dem die Menschen an Gespenster glaubten, es wurde merkwürdiger, seltsamer, vergessener – aber nicht mehr als das.
Die Schüler unseres Dorfes fanden nicht mehr so leicht eine Arbeitsstelle in den Städten, die Schüler unseres Dorfes beherrschten ja kaum die Grundrechenarten, nur von Gespenstern wussten sie zu berichten, doch außerhalb unseres Dorfes wurde solches Gerede belächelt und bemitleidet. Die Dörfer in den anderen Tälern wuchsen zu Städten heran, die spätere Geschichte des Dorfes im Tal zwischen den Drei Geschwistern ist aber eine, wie wenn eine spielende Musikkappelle weiterzieht, die immer leiser wird, bis man sie schließlich gar nicht mehr hört, und man erschrickt doch nicht, dass sie weg ist, dass man sie nicht mehr hört – wenn man sie noch hörte, das wäre weit überraschender gewesen.
Angsteinflößende Straßenschlägereien
Ich leite meine Essays mit Geschichten ein, mit Metaphern und Gleichnissen, mal selbstgestrickt, mal zitierend und herbeiziehend, und sei es an ihren würdevoll ergrauten Haaren, und ich rationalisiere eine Notwendigkeit dieser Geschichten mit zwei Argumenten…
Erstens: Ich versuche stets, zur Frage »was?« auch herauszuarbeiten, »warum es uns wichtig ist«, und die einleitende Metapher ist mir dazu ein nützliches Werkzeug – doch das ahnten oder wussten Sie bereits.
Zweitens: Erlauben Sie mir bitte eine kleine Meldung zu zitieren, welche viel zu wenige Bürger lesen, und die doch ein Zeichen für den Kurs ist, auf dem wir uns bewegen. Die erste und zweite Überschrift jener Meldung:
Fake News: Journalisten und Verlage fordern Strafen für soziale Netze – Soziale Netze sollen die EU monatlich über Maßnahmen gegen Desinformation informieren. Das reicht aber nicht aus, meinen Journalistenvertreter. (heise.de, 15.6.2020)
Am Tag nach »Köln Hauptbahnhof« hätten bekanntlich die faktisch richtigen Meldungen über Köln Hauptbahnhof als »Fake News« gegolten. Heute, am 15.6.2020 finden Sie keine Meldung auf den Titelseiten oder gar beim Staatsfunk über die französische Stadt Dijon – nichts also davon, dass dort angsteinflößende Straßenschlägereien zwischen eingereisten tschetschenischen Banden und einheimischen arabischen/nordafrikanischen Gruppen toben (francetvinfo.fr, 15.6.2020: »Dijon: Eine neue Nacht der Gewalt im Grésilles-Viertel«, und wenn Sie es jemandem in Deutschland erzählen, könnten Sie der »Fake News« geziehen werden, doch die eigentlichen, ungefilterten Bilder, die ganze Wahrheit also erfährt man eher in den Sozialen Medien unter dem Hashtag »#Dijon« – so lange, bis es die »Wahrheits-Ingenieure« anpassen. In der Covid-Krise aber waren es Staatsfunk und Politik, die an einem Tag das Gegenteil dessen sagten, was sie am Vortag laut verkündet hatten, und an beiden Tagen machten sie deutlich, dass »Verschwörungstheorie«, »Fake News« und »rechte Stimmungsmache« keine inhaltlichen Aussagen sind, sondern schlicht bedeuteten: Widerspruch.
Wir bewegen uns, vielleicht schneller als uns bewusst ist, wieder auf eine Ära der »offiziellen Wahrheit« zu. Nicht nur greifen wieder alte SED-Leute und die umbenannte SED selbst nach unserem Land, auch der alte Geist der Meinungskontrolle, der Gleichschaltung und des eiskalten Totalitarismus greift nach uns, nach unseren Herzen, nach dem Kontinent.
Es ist ohne Zweifel eine wichtige Frage für den Autoren, wie und was er heute schreiben wird – aber nicht für jeden. Wenn er Haltung statt Gewissen hat, während er für Staatsfunk oder für irgendwas mit besten Politikkontakten arbeitet, dann stellt sich die Frage weniger, denn dann schreibt er, was die multiplen Chefetagen über ihm hören wollen, und ansonsten, was sein Publikum konsequenzlos vom Wesentlichen abgelenkt hält, doch für jene Schreiber, denen die Selbstamputation des Gewissens noch nicht gelang – die es auch vielleicht gar nicht anstreben – für die stellt sich nicht nur die Frage, was wir heute schreiben, sondern dazu auch noch die, was wir morgen schreiben können/dürfen/werden.
Zwischen Zeilen
Wer in Deutschland einen TV-Sender betreiben will, der braucht eine Lizenz – und selbst wenn er nur eine gewisse Zahl von Leuten über YouTube erreicht. Dass der Staat kontrolliert, wer was sagt, das ist deutsche Tradition durch die Regimes hinweg.
Es könnte die Zeit kommen, und sie könnte schneller da sein als wir heute meinen, da wird jeder eine Lizenz brauchen, der eine Zeile schreibt, vor allem wenn er es Nachrichten nennt, oder ein Kommentar zu eben diesen.
Nein, es ist nicht nebensächlich, dass aus der Berliner und Brüsseler Politik immer und immer wieder Forderungen nach einer Art »Wahrheitsministerium« durchklingen. Wir erinnern uns etwa an die Wünsche aus der CDU, »destabilisierende falsche Meinung« zu bekämpfen (siehe Essay vom 19.12.2016). Wir erinnern uns an Ideen der »Guten«, gegen »Erinnerungsverbrechen« vorzugehen (siehe Essay vom 19.5.2019). Und wir beginnen die absehbaren Auswirkungen des latent anti-demokratischen UN-Migrationspaktes zu spüren (siehe Essay vom 2.11.2018), dessen logische Konsequenz es ist, dass ein »Wahrheitsministerium« festlegt, was die eine, offizielle »Wahrheit« zur Migration ist.
Es wird die Zeit kommen, wenn Wahrheit wieder nur noch in Metaphern, Gleichnissen und neuen Märchen erzählt werden kann. Will ich mich schon jetzt darin üben? Ich muss mich darin üben. Und wir sollten uns darin üben, die Wahrheit zwischen den Zeilen zu lesen, nicht nur zwischen den Zeilen der Staatsfunker und Haltungsjournalisten, auch die Wahrheit zwischen den Zeilen der Schreiber, die es eigentlich gut mit uns meinen, jedoch manche Wahrheit nur zwischen den Zeilen sagen können/dürfen/werden.
Andere Dörfer
Nun also zur Geschichte vom Dorf zwischen den »Drei Geschwistern«, wo gegen Gespenster zu kämpfen genügte, um an Macht, Anerkennung und Geld zu gelangen, wie doof, faul und ungeeignet man in allen übrigen Hinsichten auch war, und das daraufhin hinter andere Dörfer zurückfiel – muss ich die Geschichte wirklich noch ausdeuten? Muss ich wirklich den Fall jener Person erwähnen, die moralisch und fachlich denkbar ungeeignet scheint, um auf den Posten gehoben zu werden, auf den sie gehoben wurde, und deren einzige Qualifikation es ist, überall Gespenster, pardon: Rechte zu sehen? (Und: Was sagt es über den Zustand unserer Gesellschaft aus, dass Ihnen hier mehr als eine Person einfällt, die ich meinen könnte?)
Es ist eine nützliche Angewohnheit, sich in Fähigkeiten zu üben, bevor man überhaupt nicht ohne sie auskommt – ich überlasse Ihnen die Deutung also selbst.
Keine Gespenster?!
»Herr Wegner«, so fragte jener Leser, »warum leiten Sie Ihre Texte immer mit diesen Geschichten ein?« – Natürlich bereitet es mir Freude, doch das tut das Fahrradfahren auch.
Die Zeit wird kommen, da werden selbst die Geschichten noch die Wahrheit in ihren Schichten verstecken müssen. »Satiren, die der Zensor versteht, werden mit Recht verboten«, so sagte Karl Kraus einst, und es gilt für unsere Geschichten nicht weniger – uns also gilt es, bessere, klügere, geschicktere Metaphern zu schreiben. Die Zensoren sind böse, aber nicht (alle) blöde.
Die Masse sieht die Gespenster, welche die Propaganda in die Wohnzimmer projiziert. Wer heute keine Gespenster sieht, der sollte darauf achten, nicht selbst zum Gespenst erklärt zu werden. In der Logik derer, die ihr Geld damit verdienen, überall Gespenster zu sehen, steht einer, der keine Gespenster sieht, bald im Verdacht, selbst ein Gespenst zu sein. Doch, das ist Stoff für einer andere Geschichte…