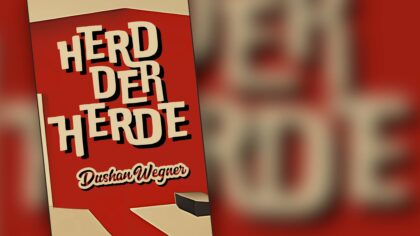Gestern beim Abendspaziergang, allein mit Hund und Gedanken, bog ich von einer Straße ab, um über einen Platz in Richtung unseres Zuhauses zu gehen (es war schon dunkel), da hörte ich unerwartet Musik und sah knapp zwei Dutzend Menschen auf Stühlen sitzen (zumeist Damen im Alter, in dem man Halstücher zu tragen begonnen und dies noch nicht wieder aufgegeben hat), die sahen einem Tänzer zu, der auf einer Bühne mit weißen Laken und violetter Farbe, wie ich später erfahren würde, »die Gewalt« darstellte.
Ich weiß, es hört sich an, wie etwas von Kafka oder Nietzsche oder wie eine Szene eines jener Filmemacher aus Zeiten, als Filmkonzerne noch Filmemacher (und nicht Wokeness-Apparatschiks) beschäftigten und immer auch dem schönen Wahnsinn genug Geld zusteckten.
Es ist so passiert: Der wohlgenährte, aber bewundernswert flexible Tänzer bog und drehte sich auf zweifellos ästhetische Weise. Er zog Grimassen zur rhythmischen Musik, doch es war nicht peinlich – er beherrschte sein Handwerk. Sogar die mich begleitende Hündin war beeindruckt. Sie bellte gar nicht, wie sie es sonst täte, wenn ein fremder Mann verdächtige Dinge tut.
Man hatte dem Tänzer eine Bühne bereitgestellt, dazu professionelle Beleuchtung und ein Soundsystem samt Personal und eigens dafür abgestelltem Fotografen.
Ich fragte mich, wie es kam, dass ein derart aufwändig produziertes und also wohl teures Event für so wenig Publikum veranstaltet wurde, doch ich gab mir auch schnell die Antwort: wahrscheinlich direkt von der deutschen Regierung gefördert. Oder indirekt von der EU.
Doch die Auflösung dieses Rätsels sollte sich bald einstellen – und das Lila von Beleuchtung und tanzend verschmierter Farbe hätte mir ein Hinweis sein sollen.
Nach Abschluss der zweifellos künstlerisch interessanten und berührenden Vorstellung trat eine der Damen vor und erklärte die Bedeutung der Darbietung: Es hatte etwas mit einem »Tag gegen Gewalt« zu tun.
Aha.
Ihre weiteren Erläuterungen ließen schnell klar werden, dass mit »Gewalt« hier speziell die häusliche Gewalt gemeint war, die natürlich laut dem Vortrag grundsätzlich von den bösen, toxischen Männern ausgehe.
Ich begriff, warum diese teure Veranstaltung mit nur spärlichem Publikum von den Behörden gefördert worden war: Es war staatlich geförderte Propaganda.
Dieses Event mit einem männlichen Einzeldarsteller, männlichen Technikern, männlichem Fotografen und vermutlich männlichen Bühnenarbeitern zum Auf- und Abbau war eine Veranstaltung der örtlichen Feministinnen-Gruppe.
Doch lassen Sie sich von den letzten Absätzen nicht irreführen: Ich will hier nicht die verquere »Gender-Debatte« verhandeln. Zwei der verbotenen Fakten bleiben, dass, zumindest in Deutschland, Frau zu sein ausschließlich rechtliche Vorteile hat, Mann zu sein hingegen bereits im Jungenalter ausschließlich massive Nachteile.
Diese spezielle Veranstaltung allerdings machte mir (neu?) bewusst: L’art pour l’art ist heute die Ausnahme. Gerade wenn Kunst öffentlich (und gar von den berüchtigten »Stiftungen«) gefördert wird, ist sie heute, weit mehr als früher, nie »nur« Kunst als Selbstzweck, will nie »nur« die conditio humana verhandeln.
Kunst muss eine politische »Botschaft« haben, um finanziert oder auf die großen Bühnen eingeladen zu werden.
Das geringste Problem ist dabei, dass solche »Kunst« eben keine Kunst ist. Die wesensschaffende Existenzberechtigung von Kunst liegt darin, durch Umreißen der vom Nichtsagbaren gebildeten Lücke ebendieses doch zu »sagen«. Wenn aber »Kunst« um eine sehr wohl formulierbare (politische) Botschaft herum konstruiert wird, ist sie halt Propaganda.
Man kann verstehen, dass der Tänzer sich für eine Propaganda-Veranstaltung einspannen ließ. Wie viele Gelegenheiten hat ein Vertreter dieser Kunst denn sonst, sich gegen Bezahlung vor einem Publikum auf ästhetische Weise zu verrenken?
Als mir klar wurde, dass ich Teilnehmer einer Propaganda-Veranstaltung war, hinterfragte ich alle für den Kunstkonsum typischen Erhabenheitsgefühle, die mich eben noch so stark ergriffen hatten.
»Die Kunst ist tot«, so dachte ich und fügte dann wie selbstverständlich an: »Lang lebe die Kunst!«
Solange auch nur ein einziger Mensch sich selbst und die Tatsache seiner Existenz betrachtet und dabei merkt, dass zwischen den verfügbaren Begriffen und dem tief Empfundenen (und dadurch Wahren) eine Lücke existiert, wird es Kunst brauchen, echte und freie Kunst, um diese Lücke zu beschreiben.
Die Vermessung der schmerzhaften Lücke zwischen Glauben und Sein nimmt ebendieser Lücke etwas von ihrem Schmerz.
Die Kunst ist nicht tot, sie wird nur neu geboren – wie immer in den dunklen Ecken, wo auch ein kleines Flämmchen seinen Zweck erfüllen kann.
Irgendwo tanzt ein Tänzer seinen guten, neuen Tanz, in welchem er auch deinen Schmerz durch seine Bewegungen beschreibt, wahr und wichtig – du musst den Tänzer nur finden. (Gewagt gesagt: Finde den Tänzer, der deinen Schmerz beschreibt – oder werde dieser Tänzer!)
Und wenn Sie in diesen Tagen und Jahren, wie ich, Schmerz ob der mangelnden Wirksamkeit künstlerischer Schmerztherapie empfinden, so hoffe ich, mit diesen beschreibenden Zeilen ein klein wenig Schmerz gelindert zu haben.
Etwa den Schmerz darüber, dass Titanen wie Thomas Gottschalk abtreten – während egal, wie tief die Sonne unserer Kultur auch stehen mag, selbst die Größten unter den Zwergen keine messbaren Schatten werfen.