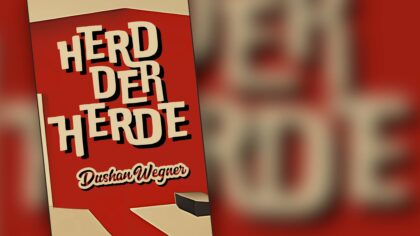Der Mensch ist kein Schnabeltier, auch nicht wenn der Mensch, wie das Schnabeltier, ein Australier sein sollte. Der Mensch ist auch kein Ameisenigel, auch wenn mancher seine Nase, metaphorisch gesprochen, gern in Ameisenhaufen steckt. (Essayisten definieren sich ja geradezu darüber – zumindest die Freien unter ihnen/Ihnen!) Eine definierende Eigenschaft jedoch teilt der Mensch mit beiden diesen possierlichen Tierchen, und jene Eigenschaft besteht darin, dass der Mensch seine Jungen säugt, biologisch und allgemein betrachtet, ob die Jungen nun Jungen oder Mädchen sind. – Der Mensch ist ein Säugetier. (Was den Menschen von den beiden genannten Tieren unterscheidet, aber mit diesen und allen anderen Säugetieren verbindet: Das Schnabeltier und der Ameisenigel sind die beiden einzigen Säugetiere, die Eier legen – die anderen Säugetiere, ob sie nun Wolle oder Milch produzieren, oder ob sie nur ganz allgemein Säue sind, bringen ihren Nachwuchs bereits lebendig zur Welt – und säugen ihn.)
Das menschliche Leben ist eine Geschichte der Flüssigkeitsaufnahme, vom Säuglingsein bis zum Altersheim. Der Milchbubi bekam in der Schule seine Milch. Später traf er sich mit Freunden auf eine Cola, wieder später traf er sich mit einem Mitmenschen des Geschlechts seiner Wahl auf einen Kaffee, was in dem einen oder anderen Fall in der Existenz weiterer Säugetiere kulminiert sein soll. Am Morgen einen Kaffee ans Bett gebracht bekommen, bei der Arbeit überraschend einen gut gebrühten Tee – es ist so viel mehr als nur Flüssigkeit!
Unsere blanke Existenz als biologische Wesen und unsere Selbstdefinition als Menschen in einem unscharfen, aber bitteschön »höheren« Sinn, diese beiden Sphären finden regelmäßig und vielfältig ihre Schnittstelle und emotionale Schnittmenge in Situationen der Flüssigkeitszufuhr, oft in Gemeinschaft, nicht selten allein.
Bislang haben wir hier jedoch nur von den Getränken gesprochen, nach deren Konsum man überall ein Auto lenken darf, und nicht etwa von jenen, von denen es in Salomons Sprüchen (Kap. 31, Vers 6f) heißt: »Gebt starkes Getränk denen, die umzukommen drohen, und Wein den bitteren Seelen. Lasst ihn trinken und seiner Armut vergessen und seines Unglücks nicht mehr gedenken.«
Neues deutsches Trankopfer
Es ist eine kleine Meldung, ein Nebensatz in einem Randkapitel im ganz großen Roman, in dem Sie, ich und der humpelnde Dackel des Nachbarn jeder seine Rolle spielt, und diese kleine Meldung hat mich berührt, und es geht in dieser Meldung um vierhundert Liter Bier.
Das schöne Pfarrdorf Bickenriede (82 Einwohner pro Quadratkilometer) liegt in Thüringen und buchstäblich mitten in Deutschland (»geographische Mitte« kann Verschiedenes bedeuten, und Bickenriede ist so oder so nah dran, siehe Wikipedia zu Bickenriede, zum Unstrut-Hainich-Kreis und zu den Mittelpunkten Deutschlands). Im schönen Pfarrdorf Bickenriede betreibt ein Herr Groß das Landhotel Bickenriede samt Berggaststätte (Informationen: landhotel-bickenriede.de).
Wie es sich für eine Berggaststätte mitten in Deutschland gehört, hält der Diplom-Hotelbetriebswirt genug von jener Flüssigkeit vorrätig, welche die wissenden Semester unter uns die »Hopfenkaltschale« zu nennen pflegen – sprich: Bier.
Es ist 2020, das Jahr des China-Virus (wenn nicht noch etwas passiert…), in Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern weltweit wurde angeordnet, dass Hotels, Restaurants und viele andere Stätten der organisierten Gemeinsamkeit geschlossen zu bleiben haben. Nun hat die Bergaststätte ein Problem, so berichtet bild.de, 3.5.2020: Man sitzt auf 400 Litern Bier, die man nicht ausschenken darf, weil jemand weit weg eine Fledermaussuppe gegessen hat oder weil irgendwas aus einem Labor ausgebrochen ist oder warum auch immer, und das offizielle Mindesthaltbarkeitsdatum seiner Hopfenkaltschale läuft ab.
Herr Groß wollte, so erfahren wir, das leckere Bier verschenken, doch auch das darf er nicht, aus demselben Grund. Supermärkte verkaufen Bier, Pizzadienste liefern Pizza, nur er darf seinen Kunden und Gästen das Bier nicht zukommen lassen, nicht einmal umsonst. Ordnung muss sein.
Also blieb nur… wegschütten. Aber halt! Alkohol einfach so wegzuschütten, zumindest außerhalb der Kehle, auch das geht in Deutschland nicht so einfach. Wenn er das Bier wegschütten wollte, müsste jemand vom Amt kommen und zugucken – oder offiziell erlauben, dass es auch ohne zugucken geht. (Nachtrag 4.5.2020: Ein Leser mit Fachkenntnis wies mich darauf hin, dass es durchaus Möglichkeiten gegeben hätte, das Bier zu verschenken. Der Gastronom hätte etwa Proben entnehmen und das Bier auf Milchsäurebefall testen lassen können, dann könnte, so meine Quelle, auch das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängert werden. Er hätte auch eine »Biersteuer«, ca. 40 Euro, zahlen können, um das Bier verschenken zu dürfen, so meine Quelle. Das Bier muss nur dann unter Zoll-Aufsicht entsorgt werden, wenn es aus dem Steuerlager entnommen wird und eben ohne Zahlung der Biersteuer in den Ausschank gehen soll, so der Leser. – Ohne jetzt weiter zu verhandeln, wie kompliziert es ist, Bier zu verschenken oder nicht wegzuschütten, scheint mir deutlich geworden zu sein: 1. Es ist kompliziert und kostet Geld, das jetzt ohnehin knapp ist, Bier nicht wegzuschütten und 2. die Kraft und symbolische Bedeutung der vom Wirt inszenierten Bilder bleiben – und die Inszenierung bestreitet ja niemand. Bier auszuschütten, das für fröhliche Abende gedacht war, ja, das ist ein schmerzhaft präzises Sinnbild für diese Tage, Wochen, Monate – wenn nicht sogar für diese ganze Ära.)
Das Drama geht also weiter, so mein letzter Infostand. Uns bleibt nur das traurige Foto in bild.de, 3.5.2020, wo Herr Groß und seine Getränkehändlerin symbolisch etwas vom Bier wegschütten, wie die Griechen einst symbolisch im Trankopfer etwas Wein auf den Boden schütteten, auf dass auch die Seelen der Toten etwas hätten, um sich zu erfreuen (siehe Wikipedia zu Trankopfer).
Nichts auf die Goldwaage
Natürlich geht es nicht nur um das Bier. Natürlich geht es nicht einmal allein um die Kosten des Bieres für den Gastronom; vierhundert Liter Bier haben gewiss ihren Preis, doch der Schaden, der ihm und anderen Unternehmen entsteht, ist ein Vielfaches der paar Fässer Bier.
Man darf mich gern sentimental nennen, auch rührselig gern, von mir aus auch gefühlsduselig, melodramatisch oder sogar larmoyant – es macht mich traurig, wenn ein Gastwirt sein Bier wegschüttet. Das Bier war dafür da, damit Kumpels sich »auf ein Bier treffen«, die großen wie kleinen Dinge der Welt »bei einem Bier« bereden – und was ansonsten jeder »bei seinem Bier« zu tun beliebt.
Wir alle hoffen – und gehen (noch) davon aus – dass es weitere Gelegenheiten geben wird, sich mit Freunden zu treffen, einfach gemeinsam Mensch zu sein, wo der Mensch noch Mensch sein darf, und nicht die Worte zählen, nichts auf die Goldwaage gelegt wird – doch die hätte es ohnehin gegeben. Die Gelegenheiten der letzten Wochen, die wir nicht nutzen konnten/durften/sollten, die sind fort, unwiederbringlich fort.
Ich war, bin und bleibe sehr bewusst und entschieden in der »Koalition der Vorsichtigen«. Lieber einmal zu häufig aufgepasst als ein Leben lang tot – jedoch: Ich will auch nicht in der Koalition der Nicht-Wahrhaben-Woller sein, zu keinem Aspekt.
Koffeinfrei, wegen des Herzens
Der Mensch ist kein Schnabeltier, und der Mensch ist auch kein Ameisenigel, auch darin nicht, dass Schnabeltiere wie auch Ameisenigel – außer wenn sie sich paaren – tatsächlich Einzelgänger sind. Und alle Menschen, die sich »Einzelgänger« nennen und von denen ich bislang gehört habe – oder die ich selbst getroffen habe – waren durchaus nicht unwillig, ihren Mitmenschen um den Preis einer Hopfenkaltschale von den Vorteilen des Einzelgängertums zu berichten, ausführlich und emotional, von ihrem Seelenleben zu berichten (»Walden, steht deine Hütte noch?«). Auch Einzelgänger schätzen die Gemeinschaft, und sei es nur, um sich selbst als Einzelgänger zu bestätigen.
Der Mensch ist kein Einzelgänger, nein. Am Anfang des Lebens wollen wir gesäugt werden, sei es an der Brust der Mutter oder mit der gewiss nahrungsreichen Fläschchenmilch, aber im Arm eines Menschen, der uns auch und gerade dann liebt, wenn wir unverständliche Geräusche machen, mal fröhlich, mal grantig, und gelegentlich dabei die Windel füllend. Gegen Ende dann treffen wir uns wieder mit Menschen, auf einen Kaffee (dann koffeinfrei, wegen des Herzens, klar), und wir hoffen, zumindest akzeptiert zu werden, obwohl nicht alles, was wir sagen, verständlich ist, obwohl die Müdigkeit uns auch mal grantig macht – und obwohl wir wieder gelegentlich die Windel voll machen. Der Mensch ist kein Einzelgänger, zu Beginn nicht, am Ende nicht, und dazwischen auch nicht – der Mensch ist nicht zum »Lockdown« geschaffen, es sind verlorene Momente, wie gutes Bier in den Abfluss gegossen.
Wat fott es…
Es war und es ist gut, und es ist richtig und wichtig, sehr vorsichtig zu sein, auch im Angesicht des Fledermaus-Virus. (Ich weiß, einige stimmen mir nicht zu, doch macht das an diesem Punkt wirklich einen Unterschied?) – Doch, vertun wir uns nicht: Jede Woche, in der wir uns nicht mit lieben Freunden getroffen haben, hat uns etwas Wichtiges gefehlt, und wie jede andere Zeit und Gelegenheit wird es nicht wiederkommen. Es ist fort, wie das Bier, das fortgeschüttet werden muss, weil die klugen und gerechten deutschen Behörden nicht erlauben, dass es ver- statt ausgeschenkt wird.
»Wat fott es, es fott«, so sagen die kölschen Weisen – die Gelegenheiten der letzten Monate sind genauso fort wie das behördlich verbotene Bier. Die Momente von gestern, das Verpasste und Vermisste – vergossenes Bier unter der Brücke. Jedoch, alles das, was eben noch nicht fort ist, das steht uns offen, als Möglichkeit, als Hoffnung, oder, um ein altmodisches, fast schon peinliches Wort zu verwenden: als Zukunft.
Wat fott es, es fott – doch jetzt, wie »die Pfauen da oben« unsere Ketten wieder ein wenig zu lockern versprechen, da ist es bald wieder Zeit, erneut dafür zu sorgen, dass das Bier nicht durch Abflüsse läuft, sondern durch Kehlen!
Ich habe in den letzten Wochen einige sehr liebe Menschen viel zu wenig getroffen, und ich freue mich sehr, das nachzuholen – gleich nachdem ich beim Friseur war. Der Mensch sollte nicht nur Mensch sein, tief in seinem Herzen – er sollte auch wie ein Mensch aussehen, besonders wenn er sich zum ersten Mal nach Wochen mit Mitmenschen trifft, zum Beispiel auf ein Bier.