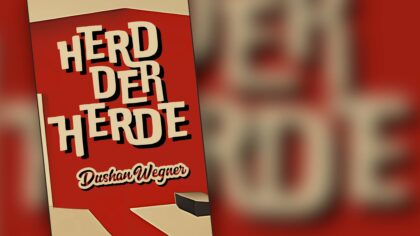Wenn ich Kinder hätte – nein, Moment, lassen Sie mich bitte neu ansetzen – ich habe ja Kinder, sie schlafen nur jetzt, während ich diesen Essay zu schreiben beginne, deshalb ist das Zwitschern der Vögel durchs Fenster meines Arbeitszimmers das lauteste Geräusch im Haus – oder ums Haus herum. Also, neuer Anfang: Ich habe Kinder, und sie prügeln sich nicht.
Kabbeln, streiten, gelegentlich triezen, einander piesacken, all das tun sie, klar, doch wer einmal mit »Problemkindern« zu tun hatte, etwa in einer Brennpunktschule, die sich wirklich prügeln, bis das andere Kind sich nicht mehr regt, sondern ohnmächtig oder vor Schmerzen stöhnend am Boden liegt, der weiß und versteht, dass das Kabbeln der einen Kinder nichts mit dem Prügeln der anderen Kinder zu tun hat.
Wenn ich aber solche Kinder hätte, die sich regelmäßig prügelten, die aus diesem oder jenem Grunde dazu neigten, andere Kinder körperlich nah an den Tod zu bringen, dann sähe mein Leben sehr anders aus.
Wir ahnen aus der Erfahrung, dass Kinder, die sich so heftig prügeln, wahrscheinlich nicht aus Haushalten stammen, die für ihre liebevolle Ordnung bekannt wären, doch es könnte und wird wohl Ausnahmen geben. Also überlege ich: Wie würde mein und unser Leben aussehen, wenn meine Kinder von der Art wären, die mit Messern aufeinander losgehen, ihren Klassenkollegen die Knochen brechen und den Schädel spalten.
Das große Volksfest
In Bremer Stadtteil Gröpelingen hat die Polizei gestern einen Menschen erschossen. Der Beiratssprecher ist Dieter Adam (SPD), sein Stellvertreter ist Raimund Gaebelein (umbenannte SED), aber nein, es war kein Republikflüchtling, der über den antifaschistischen Schutzwall in den Imperialismus fliehen wollte, der erschossen war, es war wohl ein Herr aus Marokko, der die deutsche Polizei mit einem Messer bedrohte (so etwa bild.de, 18.6.2020, butenundbinnen.de, 19.6.2020).
Im ach-so-toleranten Köln trat die Polizei derweil zunächst weniger robust auf. Als die Polizei die Papiere eines jungen Mannes prüfen wollte, und der Verdacht aufkam, diese könnten gefälscht sein (bild.de, 18.6.2020), initiierte der Kontrollierte eine praktische Debatte über die Notwendigkeit solcher Genauigkeit: »Das ist doch echt lächerlich. Für so eine Sch… macht ihr so einen Aufwand«. (Die schamvolle Auslassung bei »Sch…« stammt übrigens von bild.de selbst; eine fürwahr zarte Seele, die an diesem Bericht ausgerechnet die letzten vier Buchstaben jenes Böswortes verstören sollten.) – Nun, die Debatte verlief auf die Art, wie man es vielleicht bei der TAZ oder der Antifa für normal und richtig befindet: »Er holte aus und schlug einem Beamten ins Gesicht.« – Bald waren knapp 150 weitere junge Leute versammelt, die Polizei holte Verstärkung. Der blutenden Beamte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei zahlt den Preis der Toleranz – und nicht nur die.
Jedoch, nicht nur Deutschland ist beschäftigt. In Frankreich wurde letzte Woche in Dijon das große lokale Toleranz-Fest gefeiert (ja, Bandenkrieg, exotischerweise unter Beteiligung extra zu den Feierlichkeiten angereister Tschetschenen; bzbasel.ch, 16.6.2020: »In Dijon toben seit Tagen Strassenschlachten – und die Polizei ist hoffnungslos überfordert«).
Andere französische Städte schließen sich dem Toleranz-Volksfest von Dijon an! In den sozialen Medien kursieren Bilder von heftigsten Straßenschlägereien. Laut Augenzeugen sollen chinesische Händler ihre Geschäfte vor arabischen Banden verteidigen (Videos finden sich etwa auf Twitter unter dem Hashtag #lacourneuve).
Million Euro Bußgeld
Die Macron-Regierung hat natürlich längst eine Strategie parat, was im Angesicht der Berichte über die brutalen Konsequenzen von Toleranz und politischer Korrektheit zu tun ist, und sie ähnelt auffällig der zunehmend DDR-inspiriert wirkenden deutschen Strategie gegen »falsche Meinung«. Mitte Mai wurde in Frankreich ein offensichtlich vom deutschen Zensurgesetz »NetzDG« inspiriertes Französisches Gesetz gegen sogenannte »Hate Speech« verabschiedet (Vorlauf seit 2018, siehe jurist.org, 14.5.2020), und es war sogar unter Linken umstritten, wohl auch da man zu begreifen beginnt, dass Gesetze, die sie gegen ihren politischen Gegner erlassen, sich gegen sie selbst wenden können (vergleiche etwa zdnet.de, 14.5.2020; slate.com, 26.5.2020). Es ist die Art von Gesetzen, die sich offiziell »nur« gegen wirklich schlimme Fälle wenden, aber derart drakonische Strafen androhen, dass sie bewusst auf Übervorsicht ausgelegt zu sein scheinen: Wenn die Strafen für Verbotenes hoch genug sind (im französischen Fall bis zu einjährigen Haftstrafen und über eine Million Euro Bußgeld, siehe faz.net, 9.7.2019), wird Meinungsfreiheit de facto ausgehebelt, da Plattformen motiviert sind, regelmäßig auch Postings zu löschen, die (noch) kein Gericht verbieten würde. Während die deutsche demokratische Bundesrepublik ihr Zensurgesetz immer weiter verschärft (und einzelne davon träumen, sogar private Gespräche zu überwachen, siehe Essay vom 6.6.2020), wurde Frankreichs Zensurgesetz nun von Frankreichs Verfassungsgericht in zentralen Punkten wieder einkassiert (politico.eu, 18.6.2020). Es ist ein weiteres Argument gegen die EU-Bürokratie: Unter der zentralen Herrschaft der lupenreinen Demokraten vom Schlage einer Ursula von der Leyen würden anti-freiheitliche Gesetze wie das deutsche Zensurgesetz automatisch auf alle Regionen des Brüsseler Regimes angewendet werden – Europa braucht starke Nationen, die sich gegen die anti-demokratischen Ideen und Initiativen dubioser NGOs wehren können.
Die Kräfte, welche 1984 als Anleitung sehen, nicht als Mahnung, sie werden weiter auf Zensur und Kontrolle drängen – und sie werden weiter versuchen, zu verhindern, dass die Bürger allzu deutlich über die Folgen ihrer »toleranten« Politik diskutieren.
Zwei Szenarien
Wir könnten (und sollten) über den ethischen Preis der neuen Gewalt in Europas Städten reden. Es ist grausam und ungerecht, dass Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg hart arbeiteten, um für sich und ihre Kinder das Land neu aufzubauen, ihr Lebenswerk und ihre Hoffnung von Globalisten und Ideologen zerstört sehen müssen.
Ein weiteres, nicht minder ethisch relevantes Problem, wird heute wieder deutlich – und dieses reicht über die »nur« ethische Dimension hinaus.
Ich wünsche den Polizisten stabile Gesundheit, starke Nerven und gegebenenfalls schnelle Genesung – doch mir liegt noch ein Aspekt am Herzen: Die Mühe und das Risiko der Polizisten ist womöglich vergebens – wie soll es besser werden?
Damit es besser würde, müsste eines von zwei Szenarien eintreten: Szenario 1: Bei den relevanten Akteuren in jenen Brennpunkten müsste ein plötzlicher Kulturwandel stattfinden, eine neue Lust am Lernen, am Erschaffen und an der Höflichkeit – doch was sollte deren Motivation zum plötzlichen Geistes- und Verhaltenswandel sein? – Szenario 2: Staaten wie Deutschland oder Frankreich müssten damit beginnen, die problematischen unter den Bewohnern in ernsthafter Zahl auszuweisen, und das ist spätestens dann nicht nur unwahrscheinlich, sondern gänzlich ausgeschlossen, wenn diese die jeweilige Staatsbürgerschaft besitzen.
Das ist unsere Lage in Mitteleuropa heute: Brennpunkte werden zu Kampfzonen. Die Polizei wird aufgerieben, um Brände zu löschen, welche die Politik im Namen der »Toleranz« legt. Statt die Probleme wirksam anzugehen, lassen sich Regierungen immer neue Gesetze zur Kontrolle veröffentlichter Meinung einfallen (wenn sie nicht gerade Millionen Euro Steuergeld auf diversen Wegen an eine Auswahl von Medien leiten).
Abende mit Eliza Doolittle
Ich schreibe diesen Text an einem Freitag, und Freitags haben die Kinder nach der Schule noch Instrumente-Unterricht. Die Tochter spielt Klavier, der Sohn Violine. In der Schule nehmen sie Musicals durch, und so reden wir dieser Tage abends schon mal über Themen wie »Die Frauenrollen im Pygmalion« – oder wir gucken einfach ein Musical und haben Spaß dabei.
Wie aber wäre mein Leben, wenn unsere Kinder von der Art wären, die andere Kinder verprügeln, wenn wir am Abend nicht mit Eliza Doolittle sondern mit der Polizei beschäftigt wären? Wir würden Zeit verschwenden, so viel Lebenszeit, so viele Gelegenheiten! Jeder Tag im Leben des Kindes geschieht nur einmal – jeder Tag in jedem Leben kommt nur einmal, doch in der Zeit der Menschwerdung des Menschen schmerzen verlorene Tage doppelt. Unsere Leben und damit auch mein Leben wären andere, wenn meine Kinder von der Art Kind wären, die andere Kinder ins Krankenhaus prügelt, die sich mit der Welt in einem Zustand ewigen Krieges befindet. – Was jedoch unsere Nationen angeht, unsere Städte, unsere Zukunft, da stellt sich die hypothetische Frage anders herum.
Wie wäre die Welt beschaffen, wenn die Politik nicht einen Stadtteil nach dem anderen im Namen der Toleranz zu Zonen des Unrechts verkommen ließe, wenn sie nicht die Polizei aufriebe in einem Kampf, den sie nicht gewinnen kann? Man fragt sich, spätestens beim Blick nach Berlin, ob die Polizei den praktischen Kampf gegen das Unrecht überhaupt noch gewinnen soll.
Handeln vom Innenhof aus
Es gibt kein Leben im Konjunktiv. Das Bedenken möglicher Welten kann uns reichlich sentimental werden lassen, und das ist ja nicht unangenehm, doch es sind Gefühle aus der Abwesenheit heraus, aus dem Mangel. Das echte Leben ist das Leben, das wir leben, nicht das Leben, das wir uns vorstellen – und auch nicht das Leben, das wir fürchten.
Der beste Zeitpunkt, sich seinen eigenen Innenhof einzurichten, wäre vor Jahren gewesen, etwa Ende 2018, als ich »Das Lied der Innenhöfe« schrieb – der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Die Zahl der Leser wird größer, die mir schreiben, dass sie sich bewusst ihren »Innenhof« einrichten, ihre »Relevanten Strukturen« definieren – und sich ansonsten aus der Politik heraushalten wollen.
Ich verweigere mich, damals wie heute, allen Illusionen – und ich verweigere mich zugleich dem Sich-Abfinden. Es wäre brandgefährlich, die Augen zu verschließen vor dem, was linksgrüner Wahn mit Land und Gesellschaft anrichtet. Ich weiß nicht, wie viel wir noch retten werden, wie viel wir überhaupt noch retten können – manche Entwicklungen sind wie Hochseetanker, die zu wenden es viele, viele Meilen braucht (siehe auch den Essay vom 10.10.2018). Ich weiß aber, dass wenn ich es nicht zumindest versuche, und sei es als steter Tropfen, der den Riesenstein auszuhöhlen bemüht ist, ich mich ein Leben lang fragen würde (und dass meine Kinder es fragen würden, hoffe ich), was gewesen wäre, wenn ich es doch versucht hätte.
Unsere erste Aufgabe ist heute, unser Leben in dieser Realität zu gestalten – doch unsere zweite Aufgabe kann (oder: sollte? muss?) es sein, selbst mit unseren kleinsten Möglichkeiten gegen den Sturm anzupusten, schon um uns nicht der Frage stellen zu müssen, was gewesen wäre, wenn wir es doch versucht hätten.
Viele von uns tragen Verantwortung für einige liebe Menschen. Jeder von uns trägt Verantwortung für sein eigenes Leben, und diese Verantwortung gilt es zu tragen, aus dieser Verantwortung heraus gilt es zu handeln. Es gibt kein Leben im Konjunktiv!