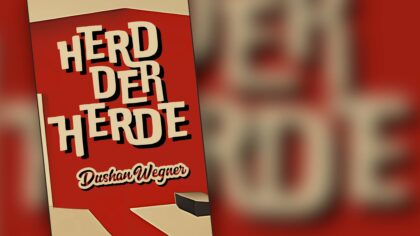Es war einmal eine Zeit, da standen in deutschen Städten kleine Boxen, in denen war eine Art »übergroßes Senioren-Handy« fest installiert (also ein Smartphone, mit dem man nichts als telefonieren konnte).
Und außerdem war darin – ja, es klingt irre, doch es ist wahr! – ein dickes Buch, in welchem die Namen fast aller Einwohner der Stadt standen. (Die Spitzenzahl lag mit 160.000 Telefonzellen im Jahr 1994; so Wikipedia.)
Sogar die Adressen standen dabei! Ja, die Adresse, wo man wohnte. Sogar die Telefonnummern standen dabei!
Das Buch hieß deshalb auch »Telefonbuch«, und es lag nicht nur in den Telefonzellen aus, es wurde den Leuten nach Hause gebracht.
Sicher, man konnte darum bitten, nicht darin gelistet zu werden. Und wenn man das nicht von vornherein getan hatte, wurde man dann ab dem nächsten Neudruck des Telefonbuchs eben nicht mehr erwähnt. Doch dann war man eben »unsichtbar« für alle Fremden, denn ein Internet gab es damals nicht.
Es lebt – noch
Auch wenn es uns nicht bewusst ist: Diese »Telefonbücher« gibt es bis heute! Irgendwer druckt sie immer noch, denn irgendwer bezahlt ihn dafür. Früher wurden sie einem nach Hause gebracht. Oder man erhielt eine Postkarte, mit der man sich genau ein wertvolles Exemplar abholen durfte. Heute liegen sie oft stapelweise herum, etwa im lokalen Supermarkt, und jeder kann sich so ein Telefonbuch mitnehmen – mit Tausenden persönlichen Kontaktdaten.
Es ist ein charmantes Absurdum: Die Monsterbehörde »EU« vermiest uns den Besuch jeder einzelnen Website mit Cookie-Klicks »für den Datenschutz« – gleichzeitig werden Bücher mit tausenden Namen, Adressen und Telefonnummern verteilt.
Falls Sie sich aber kaum erinnern können, wann Sie zuletzt ein Telefonbuch in der Hand hielten, sind Sie nicht allein. Ich habe meine Twitter-Follower danach gefragt, und bei einigen von Ihnen liegt der letzte papierne Telefonbuch-Kontakt ein Jahrzehnt zurück! Siehe: @dushanwegner.com, 10.2.2023)
Ein Teil meiner Leser wird jetzt zum ersten Mal von der folgenden Internet-Adresse hören, und von diesen wiederum wird ein Teil sogleich ausprobieren wollen, ob sie oder ihre Freunde dort zu finden sind, oder ob sie sich haben austragen lassen. Das Telefonbuch gibt es heute immerhin auch online, und dann auch bundesweit: dastelefonbuch.de.
(An dieser Stelle haben wir uns von allen »Suchenden« verabschiedet – oder wir begrüßen die Rückkehrer.)
Vom Grundvertrauen
Das Telefonbuch stammt aus einer Zeit, in welcher wir wenig Probleme damit hatten, dass alle Menschen der Stadt unsere Daten kennen. Und wenn wir kein Telefonbuch zur Hand haben, aber wissen, in welcher Stadt die gesuchte Person wohnt, gibt es bis heute eine Telefonnummer, die man als »Auskunft« anrufen kann. (»11 8 33« fürs Inland, doch sie ist inzwischen so richtig teuer, nämlich 1,99 € aus dem Festnetz – ohne Gewähr.)
Das erste deutsche Telefonbuch erschien 1881 in Berlin und enthielt 185 Beiträge. Laut Wikipedia waren die Berliner auch damals schon recht kritisch gegenüber technischer Modernisierung und spotteten über die »Narren«, die auf den »Schwindel aus Amerika« hereinfielen und sich eine »Fernsprecheinrichtung« installieren ließen.
Das Telefonbuch aber setzt ein Grundvertrauen voraus, und dieses grundsätzliche Vertrauen ließe sich etwa so beschreiben: »Ich vertraue den meisten Mitmenschen und auch den meisten Unternehmen so weit, dass sie zu meinem Namen auch meine private Adresse und meine Telefonnummer haben dürfen – und sollen – da sie damit zumeist keinen Schindluder treiben werden.«
Ein Gegensatz
Zu jener Zeit, in der die meisten von uns problemlos überall unsere Kontaktdaten verteilen ließen, bestand man zugleich auf Werten wie dem Briefgeheimnis nach Grundgesetz nach Art. 10 oder der Unverletzlichkeit der Wohnung nach Grundgesetz Art. 13, Absatz 1 – lang ist’s her.
Heute senden wir unsere Briefe elektronisch, und da ist wenig geheim. Wir holen uns die Wanzen selbst nach Hause. Politik und Polizei setzen derweil recht offen Hausdurchsuchungen als eigene Form von Strafe ein. (Und selbst wenn Gerichte das später als »rechtswidrig« beurteilen, bleibt das ohne Konsequenzen für die verantwortlichen Genossen, es bleibt nur mit Trauma für die Kinder der zu Unrecht durchsuchten Opfer – und die »Warnung« für alle übrigen Bürger; siehe auch sueddeutsche.de, 5.2.2022.)
Das Telefonbuch stammt aus der Zeit eines gewissen Grundvertrauens. Vertrauen in unsere Mitbürger (mit denen wir damals auch, seien wir stets ehrlich, auch öfter die Sprache und weite Teile des Wertekostüms teilten). Generelles Vertrauen in den Staat, auch weil er sich, soweit wir es sehen und fühlen konnten, zumeist in den vom Grundgesetz geschützten Bereichen auch wirklich selbst bremste.
Graben und Gründe
Es hat sich gedreht. Wir vertrauen den Mitbürgern nicht mehr wie früher. Ein Grund ist, dass durch moderne Lebenspläne und gewisse politische Faktoren es immer seltener ist, dass lokale Netzwerke über Jahre wachsen können. Wir kennen immer weniger der Menschen, mit denen wir in unserer Stadt zu tun haben.
Ein weiterer Grund fürs schwindende Grundvertrauen könnte sein, dass Politik und Propaganda täglich das Misstrauen gegenüber dem Nächsten ins Volk säen. Ich habe darüber geschrieben, siehe dazu etwa die Essays »Hast du deinem Verräter die Windeln gewechselt?« oder »Eine Brücke über den großen Graben«.
Es wird wohl mehr als ein Grund sein, eine Kombination aus vielen Gründen gleichzeitig, aus den genannten Gründen und weiteren.
Abhängigkeit ist nicht …
Jedoch, das Grundvertrauen zum Mitbürger, das sich im Telefonbuch ausdrückt, ist nicht übergegangen in ein Vertrauen auf den Staat und seine Behörden.
Wir vertrauen den Mitmenschen prinzipiell weniger, doch wir vertrauen dem Staat nicht damit automatisch mehr. Erzwungene Abhängigkeit ist nicht Vertrauen – Stockholm-Syndrom auch nicht.
Der Staat verlangt, dass wir ihm vertrauen, wie oft er uns auch enttäuscht hat – und wenn wir aus leidvoller und wiederholter Erfahrung misstrauisch werden, beschimpft man uns und will uns für unser wohlbegründetes Misstrauen bestrafen (womit man unser Misstrauen natürlich noch weiter bekräftigt).
Symbol und Symptom
Ich kann mich verschwommen daran erinnern, als zum ersten Mal der Name meiner Eltern samt Adresse und Telefonnummer in einem deutschen Telefonbuch stand. Wir begutachteten es stolz gemeinsam am Küchentisch. Es war ein Dokument des Angekommenseins, hochoffiziell und vieltausendfach an alle Haushalte der Stadt verteilt.
Als ich selbst zum ersten Mal ein Telefon auf meinen eigenen Namen bestellte, tat ich das nicht mehr bei der Post, sondern bei der Telekom. Nicht im Telefonbuch zu stehen erschien mir ebenso selbstverständlich, wie es früher selbstverständlich war, auf jeden Fall im Telefonbuch zu stehen und stolz darauf zu sein.
Erst heute wird mir bewusst, dass die gegensätzliche Selbstverständlichkeit meines Handelns auch Symbol und Symptom eines neuen Verhältnisses zur Gesamtgesellschaft war. Ich wollte nicht, dass mir ganz Fremde meine Telefonnummer haben – denn sie waren mir eben Fremde.
Ein Mitbringsel
Seufz, sie wird nicht so bald wiederkommen, jene mythische Zeit, in welcher wir allen Menschen grundsätzlich vertrauten und buchstäblich aller Welt unsere Telefonnummer gaben – und problemlos ans Telefon gingen, obwohl vor der Rufnummernanzeige ja alle Nummern »unterdrückt« waren.
Jene Zeit ist vorbei, und die Telefonbücher auf Paletten im Supermarkt, die einige von uns zuletzt vor einem Jahrzehnt tatsächlich benutzten, sie sind ein sentimental stimmendes, und zugleich etwas absurdes Souvenir. Wie ein Mitbringsel aus der Reise mit der Zeitmaschine.
Umso wertvoller ist der Kreis der Menschen, die heute unsere Telefonnummer gespeichert haben und uns anrufen können, wenn sie möchten – und die wir dann nicht wegdrücken, sondern bei denen wir mit einem Lächeln drangehen.
Unter denen, denen wir unsere Telefonnummer gaben, finden sich hoffentlich auch einige, von denen wir sagen können, dass wir ihnen vertrauen.